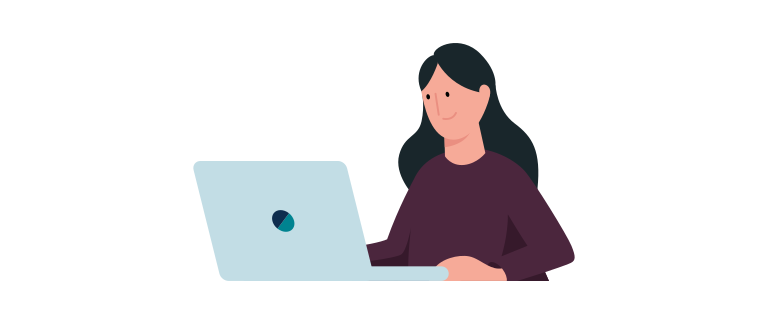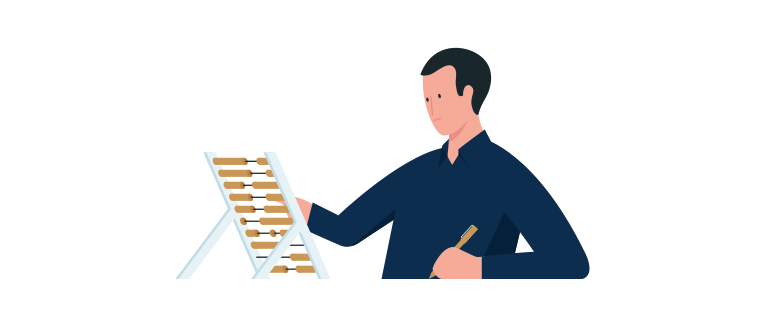Die Elektroauto-Batterie-Versicherung greift bei Kaskoschäden am Energiespeicher Ihres Elektro-Pkw (z. B. Lithium-Ionen-Akku). Mitversichert ist die E-Auto-Batterie über die Elektroauto-Versicherungen der Allianz mit Vollkasko oder Teilkasko – in allen vier Produktlinien Direct, Direct Plus, Komfort und Premium. Die Kfz-Haftpflicht hingegen beinhaltet keine Akku-Versicherung für das eigene E-Fahrzeug. Sollten Sie bei einem Autohersteller die E-Auto Batterie mieten, greift die Allianz Elektro-Batterie-Versicherung nicht.
Welche Leistungen die Versicherung für die Batterie Ihres Elektroautos bietet, kommt auf die Versicherungsart an:
- Die Teilkasko beinhaltet unter anderem eine Akku-Brand-Versicherung und erstattet bei Diebstahl des Ladekabels Ihres E-Autos die Kosten.
- Die Vollkaskoversicherung leistet zum Beispiel auch bei Schäden, die durch selbst verschuldete Unfälle am Akku entstehen. Zudem beinhaltet sie in den Produktlinien Komfort und Premium eine Wallbox-Versicherung, die beispielsweise Schäden durch Vandalismus oder Unwetter an Ihrer fest installierten E-Auto-Ladestation abdeckt.
Bei welchen Beschädigungen die Batterie-Versicherung für Ihr Elektroauto noch greift, zeigt diese Tabelle: