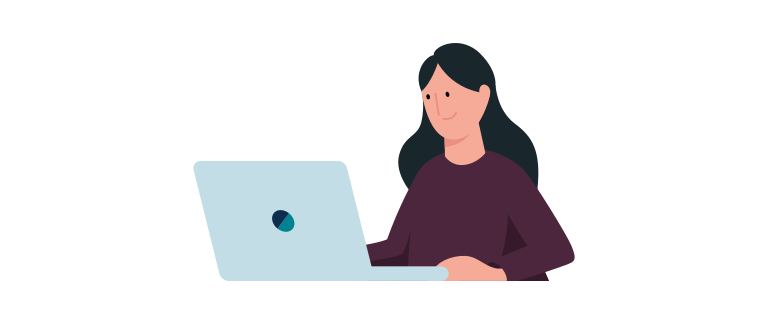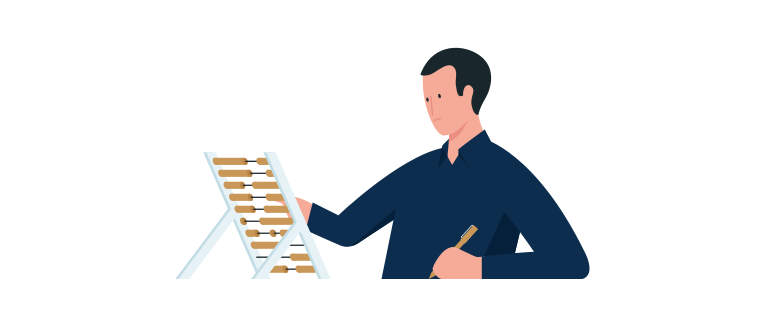PKV und GKV unterscheiden sich sowohl bei den Beiträgen und den Voraussetzungen, vor allem aber beim Leistungsumfang und bei der Kostenübernahme. Hier folgen Sie zwei unterschiedlichen Prinzipien:
Versicherte der GKV erhalten durch das Sachleistungsprinzip medizinische Leistungen. Für diese müssen sie nicht selbst in Vorleistung treten. Die Leistungserbringer (z. B. Allgemeinmediziner:innen, Fachärzte und Fachärztinnen, Zahnärzt:innen, Krankenhäuser) rechnen nicht mit Ihnen als Patientin und Patient ab, sondern direkt mit den Krankenkassen oder kassenärztlichen Vereinigungen.