- Rechtssicherheit: Alle staatlichen Maßnahmen sowie alle Entscheidungen von Verwaltung und Justiz müssen auf geltenden Gesetzen beruhen. Soll ein neues Gesetz erlassen werden, muss dieses mit der Verfassung vereinbar sein. Die Grundrechte sind dabei unumstößlich und müssen gewahrt werden. Nur wenn all dies gewährleistet ist, können sich Bürger auf die geltenden Gesetze verlassen und die rechtlichen Folgen ihres eigenen Handelns korrekt einschätzen.
- Gewaltenteilung: In einem Rechtsstaat herrscht Gewaltenteilung. Das bedeutet, dass Legislative (gesetzgebende Gewalt), Judikative (richterliche Gewalt) und Exekutive (ausführende Gewalt) streng voneinander getrennt sind. Ein Beispiel: Als gesetzgebende Gewalt kann das Parlament beispielsweise ein neues Steuergesetz erlassen. Für die Umsetzung dieses Gesetzes wäre etwa das Finanzamt als ausführende Gewalt zuständig. Gehen Sie als Bürger nun davon aus, dass dem Finanzamt ein Fehler unterlaufen ist und dass Ihr Steuerbescheid nicht mit dem neuen Gesetz vereinbar ist, dann muss dies im Zweifelsfall von einem unabhängigen Gericht in seiner Funktion als richterliche Gewalt überprüft werden.
- Rechtsgleichheit: Gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. In einem Rechtsstaat hat damit jeder dieselben Rechte und Pflichten.
- Rechtskontrolle: Der Rechtsweg steht jedem offen. Bürger, die ihre eigenen Rechte verletzt sehen, können rechtlich gegen Mitbürger, Unternehmen und sogar gegen den Staat selbst vorgehen. Wer im Recht ist, wird von einem unabhängigen Gericht entschieden.
Was ist ein Rechtsstaat?

Die meisten wissen, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um einen Rechtsstaat handelt – genauer gesagt um einen republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Was das genau bedeutet, wissen jedoch nur wenige. Dabei gewährleistet der Rechtsstaat unter anderem, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen fairen Zugang zum Recht haben.
Vereinfacht gesagt heißt „Rechtsstaat“, dass Regierung und andere staatliche Organe sich an geltende Gesetze halten müssen und nicht willkürlich handeln dürfen. So darf Ihnen die Polizei etwa nur dann einen Bußgeldbescheid ausstellen, wenn Sie eindeutig gegen die Straßenverkehrsordnung oder andere klar festgeschriebene Regelungen verstoßen haben. Sehen Sie Ihr Recht verletzt, können Sie in einem Rechtsstaat jederzeit förmlichen Widerspruch bei der jeweiligen Verwaltungsbehörde einreichen. Bleibt der Erfolg aus, können Sie vor Gericht ziehen. Dieses Element des Rechtsstaats wird auch als Rechtsweggarantie bezeichnet. Wenn Sie in schwerwiegenderen Fällen Ihre Grundrechte verletzt sehen, dann können Sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und Verfassungsbeschwerde einlegen.

In welchen Fällen der Rechtsstaat greift
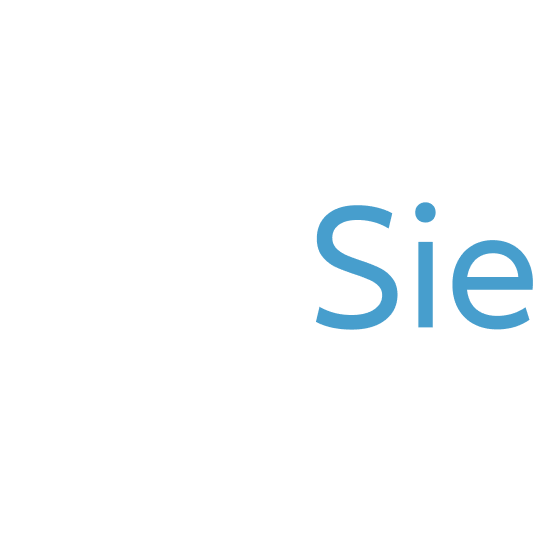
Jetzt Rechtsberatung in Anspruch nehmen!
Haben Sie Fragen zur Rechtsschutzversicherung?

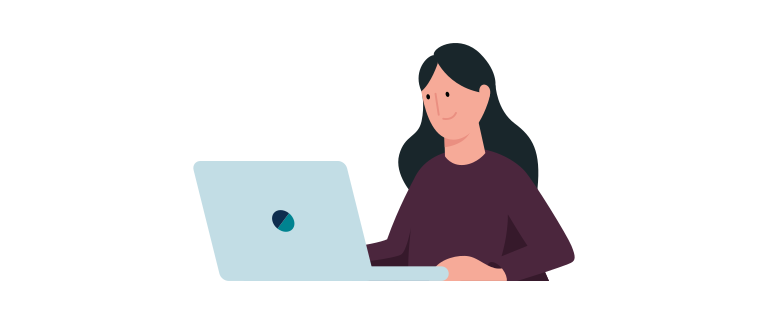
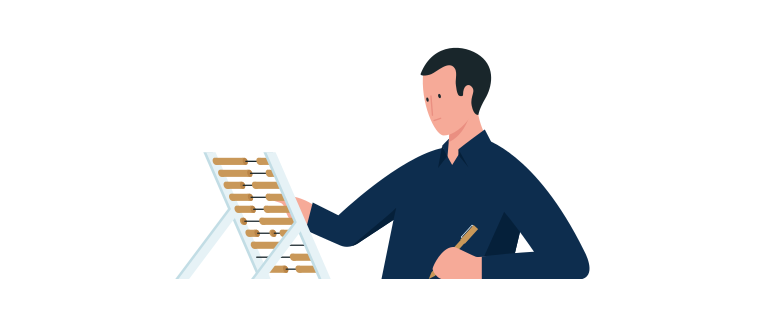
passenden Tarif






