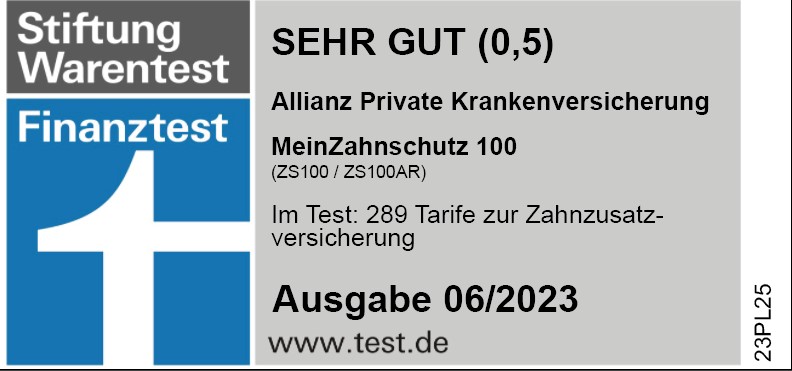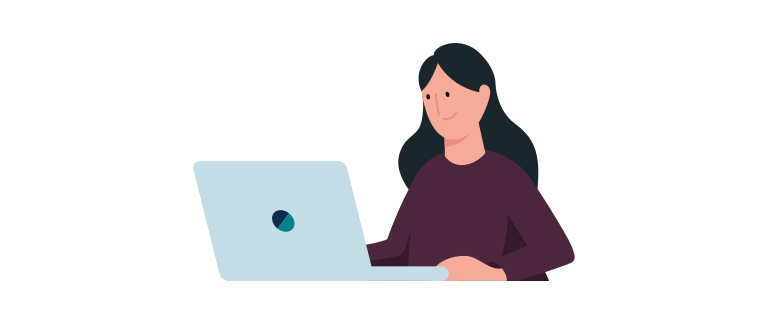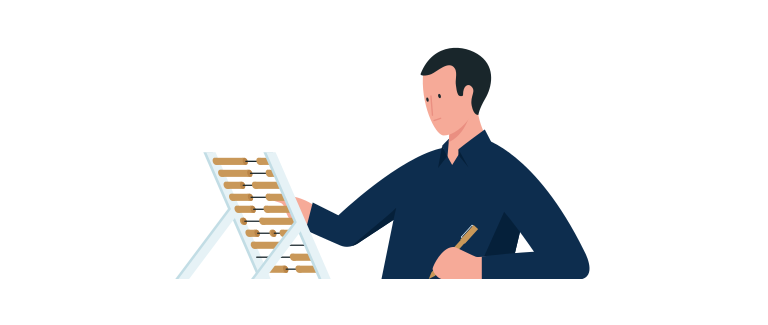Mittels Funktionsanalyse oder Funktionsdiagnostik, in der Zahnheilkunde auch als Gnathologie bekannt, lassen sich präzise Analysewerte erheben. Anhand dieser Daten können Zahnärztin oder Zahnarzt die individuelle Mund- und Kiefersituation exakt bewerten:
- die Lage des Kiefers im Schädel
- die Bewegung der Kiefergelenke
- die Stellung der Zähne zueinander