Pflegepauschbetrag: So reduziert er die Steuerlast
- Einen pflegebedürftigen oder ständig hilflosen Menschen zu betreuen, kostet viel Kraft, Zeit und Geld. Der Staat unterstützt diese persönliche, unentgeltliche Fürsorge mit dem sogenannten Pflegepauschbetrag.
- Private Pflegepersonen, z. B. Angehörige, können diesen jährlichen Pauschbetrag in Ihrer Steuererklärung in der Anlage "Außergewöhnliche Belastungen" beantragen. Wenn Sie die Voraussetzungen für den Pflegepauschbetrag erfüllen, wird dieser ohne Nachweis gewährt.
- Ab 2021 erhalten Sie den Pflegepauschbetrag in Höhe von maximal 1.800 Euro bereits ab Pflegegrad 2 oder bei Hilflosigkeit. Hierfür müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
- Mit einerprivaten Pflegezusatzversicherung können Sie schon jetzt Vorsorgelücken schließen. Es ist sinnvoll, bereits vor Eintreten eines Pflegefalls vorzusorgen.

Weil du leider nicht für immer jung bleibst.

- Drei von vier Menschen werden in Deutschland pflegebedürftig.
- Im Pflegefall reichen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung oft nicht aus – deshalb ist private Vorsorge wichtig!
- Die Allianz steht Ihnen als starker Partner zur Seite mit einer Pflegezusatzversicherung – für beispielsweise 14,72 Euro pro Monat.
Tatsächliche Kosten oder Pflegepauschbetrag von der Steuer absetzen?
Nachweispflicht und Belegvorhaltepflicht
Im Gegensatz zum jährlich festgesetzten Pflegepauschbetrag besteht eine Nachweispflicht, wenn Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben geltend machen. Das heißt: Sie müssen die Höhe Ihres finanziellen Aufwands anhand von Rechnungen und Quittungen belegen können.
Seit 2018 gilt hierbei die sogenannte Belegvorhaltepflicht: Sie reichen die Rechnungen nicht mit Ihrer Steuerklärung beim Finanzamt ein. Halten Sie die Belege aber im Falle der Prüfung für Ihren Steuerbescheid bereit.
Zumutbare Eigenbelastung
Tragen Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben in der Steuererklärung ein, werden diese nicht in voller Höhe als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt. Der Betrag, ab welchem das Finanzamt außergewöhnliche Belastungen anrechnet, ist nicht für jeden Steuerzahler gleich. Warum?
Das Finanzamt zieht eine sogenannte zumutbare Eigenbelastung ab, die sich nach Einkünften, Familienstand und der Zahl Ihrer Kinder richtet. Die zumutbare Belastung beträgt zwischen einem und sieben Prozent der Gesamteinkünfte Ihres Haushalts: Leben Sie allein, ist der Gesamtbetrag Ihrer eigenen Einkünfte gemeint. Bei Ehegatten dient die Summe der gemeinsamen Einkünfte als Berechnungsgrundlage für die zumutbare Eigenbelastung.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht über die zumutbare Eigenbelastung je nach Familienstand und Haushaltseinkommen. Staffelung gemäß § 33 Absatz 3 EStG:
Tabelle: Zumutbare Eigenbelastung nach Familienstand und Haushaltseinkommen
Wischen um mehr anzuzeigen
|
Familienstand
|
Gesamtbetrag aller Einkünfte des Haushalts*
|
||
|---|---|---|---|
| bis 15.340 Euro | ab 15.340 bis 51.130 Euro | ab 51.130 Euro | |
| Alleinstehende bzw. einzeln veranlagte Ehegatten ohne Kinder | 5 % | 6 % | 7 % |
| Zusammenveranlagte Eheleute ohne Kinder | 4 % | 5 % | 6 % |
| Alleinstehende und Eheleute mit 1 oder 2 Kindern | 2 % | 3 % | 4 % |
| Alleinstehende und Eheleute mit 3 oder mehr Kindern | 1 % | 1 % | 2 % |
Was ist steuerlich sinnvoller: Außergewöhnliche Belastungen oder Pauschbetrag?
Um herauszufinden, was für Sie als Pflegeperson steuerlich günstiger ist, gehen Sie am besten wie folgt vor:
- Berechnen Sie die zumutbare Eigenbelastung für Ihren Haushalt anhand Ihres Haushaltseinkommens.
- Ziehen Sie den errechneten Betrag von Ihren tatsächlichen Gesamtausgaben für Ihre Pflegetätigkeit ab.
- Prüfen Sie das Ergebnis: Liegt dieser Betrag über dem Pflegepauschbetrag, den Sie abhängig vom Pflegegrad "Ihrer" pflegebedürftigen Person erhalten würden?
Wenn ja: Für Sie lohnt es sich, Ihre tatsächlichen Pflegekosten in der Steuererklärung anzusetzen.
Wenn nein: Sparen Sie sich die Auflistung der Einzelposten für Ihre tatsächlichen Pflegeausgaben. Für Sie ist es sinnvoller, den Pflegepauschbetrag geltend zu machen.
Bitte beachten Sie, dass dieser Ratgeber vereinfachte, pauschalierte Informationen bietet. Im Zweifel gehen Sie bitte zum Beispiel auf eine Rechtsanwältin oder einen Steuerberater zu und lassen sich beraten.
Gilt ein steuerrechtlicher Unterschied zwischen hilflos und pflegebedürftig?
-
Pflegebedürftig
Pflegebedürftig sind Personen, die
- wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung
- für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
- auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen (§ 14 SGB XI – Elftes Buch Sozialgesetzbuch)
Fazit: Wird eine Person mit Pflegegrad 2 bis 5 unentgeltlich gepflegt, so kann der Pflegepauschbetrag beantragt werden.
Personen mit Pflegegrad 1 bis 3 sind steuerrechtlich gesehen nur "pflegebedürftig", jedoch nicht "hilflos".
-
Hilflos
Hilflos sind Personen, die
- zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz
- für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen
- im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. (§ 33b Abs. 6, Abs. 3 S. 4 EStG)
Der Nachweis der Hilflosigkeit erfolgt über eine Einstufung in die Pflegegrade 4 oder 5 (früher mindestens Pflegestufe 3). Alternativ sollte ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen "H" vorliegen. Eine ärztliche Bescheinigung reicht hier nicht.
Fazit: Personen mit Pflegegrad 4 oder 5 sind sowohl "hilflos" als auch "pflegebedürftig". Wird eine hilflose Person gepflegt, kann die pflegende Person den Pflegepauschbetrag, alternativ ggf. auch den erhöhten Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro beantragen.
Wer hat Anspruch auf den Pflegepauschbetrag?

- Unentgeltlichkeit der Hilfeleistung: Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie für die Betreuung und Pflege keine Bezahlung erhalten. Indem Sie die Person unentgeltlich unterstützen und pflegen, erfüllen Sie stattdessen eine sittliche Pflicht. Professionelle (ambulante) Pflegedienste, die ihre Dienstleistung in Rechnung stellen, können den Pflegepauschbetrag folglich nicht steuerlich geltend machen.
- Grad der Pflegebedürftigkeit oder Hilflosigkeit: Die zu pflegende Person muss pflegebedürftig oder hilflos und auf Unterstützung im Alltag angewiesen sein.
- Persönliches Verhältnis: Den Pflegepauschbetrag erhalten Angehörige oder Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in einer engen persönlichen Beziehung stehen. Dazu gehören Ehepartner:in, Kinder, Eltern oder weitere nahestehende Verwandte. Ein Verwandtschaftsverhältnis ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Das Finanzamt erkennt auch enge freundschaftliche Beziehungen zu Nachbarn oder Bekannten an.
- Ort der Pflege: Die Betreuung hat in häuslicher Umgebung stattzufinden. Entweder in der Wohnung der gepflegten Person oder zu Hause bei der pflegenden Person (Pflegeperson). Seit 2013 gilt diese Regelung nicht nur für Wohnungen in Deutschland, sondern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (d.h. Europäische Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
- Steueridentifikationsnummer:
Die Person, die den Pflegepauschbetrag beantragt, muss in ihrer Einkommensteuererklärung die Steuer-ID der gepflegten Person angeben.
So können Sie den Pflegepauschbetrag beantragen
Wie bekomme ich den Pflegepauschbetrag?
Um den Pflegepauschbetrag zu erhalten, sindin der Regel keine Nachweise erforderlich. Das heißt: Sie müssen die Unterlagen nicht proaktiv vorlegen. Etwas Anderes gilt bei Erstanmeldungen/Erstbeantragung oder Änderungen: Dann sollten Sie Ihrem Antrag entsprechende Nachweise beilegen.
Unabhängig davon kann das Finanzamt jederzeit überprüfen, ob Sie die Voraussetzungen für den Pflegepauschbetrag tatsächlich erfüllen. So kann die Behörde zum Beispiel einen glaubhaften Nachweis Ihrer Pflegetätigkeit fordern (Nachweispflicht). In der Regel reicht dafür eine gültige Vorsorgevollmacht aus.
Darüber hinaus sollten Sie beweisen können, dass Sie keine Bezahlung für Ihre Pflegeleistung erhalten. Das Finanzamt kann den Pflegegrad oder die Hilflosigkeit des Patienten überprüfen. Dann ist ein Beleg der Pflegekasse über den Pflegegrad beziehungsweise über die Hilflosigkeit/Sehbehinderung erforderlich. Entsprechende Kennzeichnungen sind im Behindertenausweis zu finden.
Was Sie noch über den Pauschbetrag wissen sollten
-
Ist die zeitweise Unterstützung durch externe Pflegedienste erlaubt?
Ja. Werden Sie stundenweise von einer Tagespflege oder ambulanten Pflegekraft unterstützt, steht dies der Gewährung Ihres Pauschbetrags nicht im Wege. Es ist erlaubt, einen professionellen(ambulanten) Pflegedienst als Unterstützung zu beauftragen.
Damit Sie den Pflegepauschbetrag beantragen können, ist jedoch eine eigene Pflegeleistung von mindestens zehn Prozent erforderlich. Liegt Ihr Beitrag darunter, entfällt der Anspruch auf Steuerersparnis. Zudem darf die externe Pflegeunterstützung nicht dauernd oder zeitgleich mit Ihnen tätig sein.
-
Welcher Pflegegrad ist bei veränderter Pflegebedürftigkeit maßgeblich?
Bei Beginn, Änderung oder Wegfall des Pflegegrades oder der Hilflosigkeit im Laufe eines Kalenderjahres ist der Pauschbetrag stets nach dem höchsten Pflegegrad zu gewähren, der im Kalenderjahr festgestellt wurde. -
Können sich Pflegepersonen den Pauschbetrag teilen?
Was, wenn Pflegepersonen die pflegebedürftige bzw. hilflose Person zu zweit betreuen? Dann erhalten Sie den Pflegepauschbetrag anteilig jeweils zur Hälfte. Die Aufteilung des Zeitaufwands untereinander ist dafür unerheblich. Selbst wenn Sie 80 Prozent der pflegerischen Leistung erbringen, erhalten Sie nur die Hälfte des Pauschbetrags, anstatt einer Aufteilung des Pflegepauschbetrags zeitanteilig. -
Ist der Pflegepauschbetrag auch mehrfach möglich?
Umgekehrt zum anteiligen Erhalt des Pflegepauschbetrags gilt: Bei häuslicher Pflege mehrerer Personen, zum Beispiel beider Elternteile, erhalten Sie den Pauschbetrag auch mehrfach. Die Steuerermäßigung wird Ihnen dann doppelt angerechnet. -
Kann ich den Pflegepauschbetrag auch rückwirkend geltend machen?
Sie können den Pflegepauschbetrag auch rückwirkend geltend machen. Zum Beispiel, wenn die Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 2-5) oder die Hilflosigkeit der zu pflegenden Person erst nachträglich feststeht. Das kann auch nach der Festsetzungsfrist möglich sein, die vier Jahre dauert.
Sie sind sich unsicher, wie Sie den Pauschbetrag rückwirkend beantragen können? Dann empfiehlt sich ein Besuch bei Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin. Sie wissen genau, welche Unterlagen auszufüllen und welche Fristen einzuhalten sind.
Die fünf Pflegegrade
-
So werden die fünf Pflegegrade berechnet
Mehr Informationen zu den Pflegegraden finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber.
Hohe Kundenzufriedenheit beim Online-Antrag unserer Versicherungen

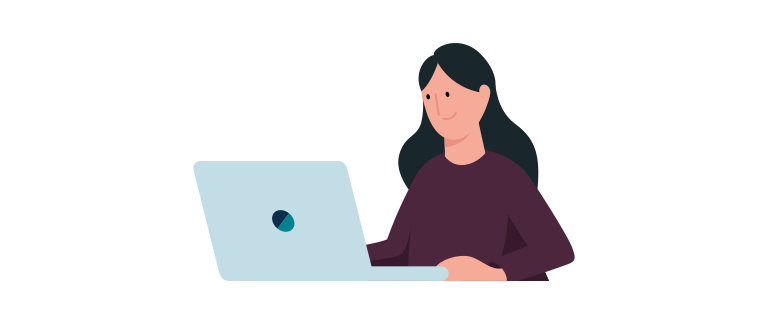
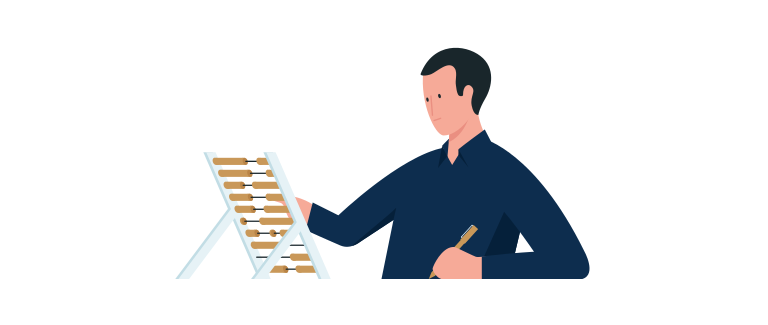
passenden Tarif





