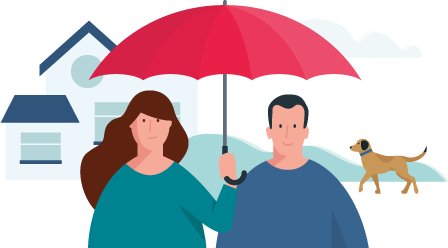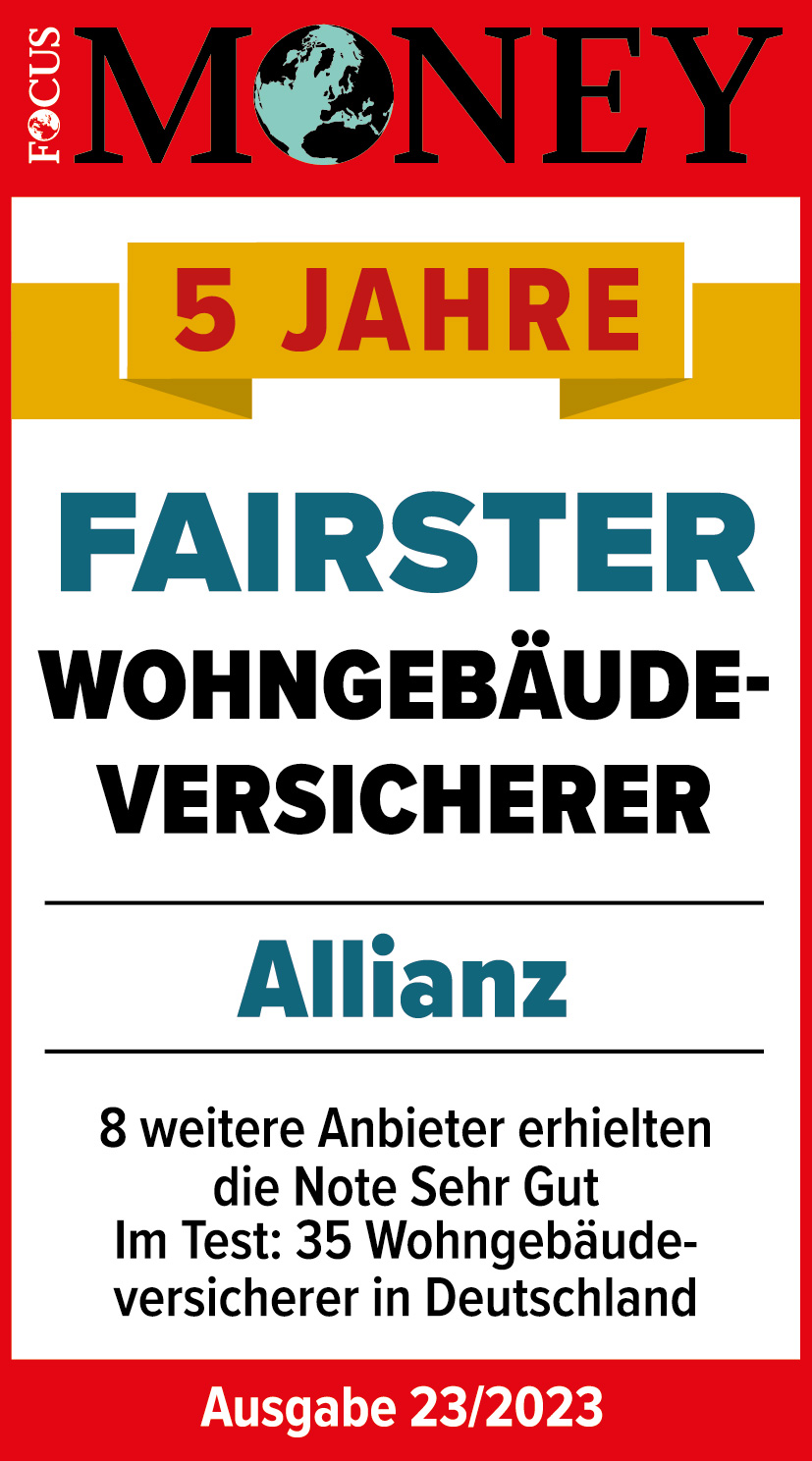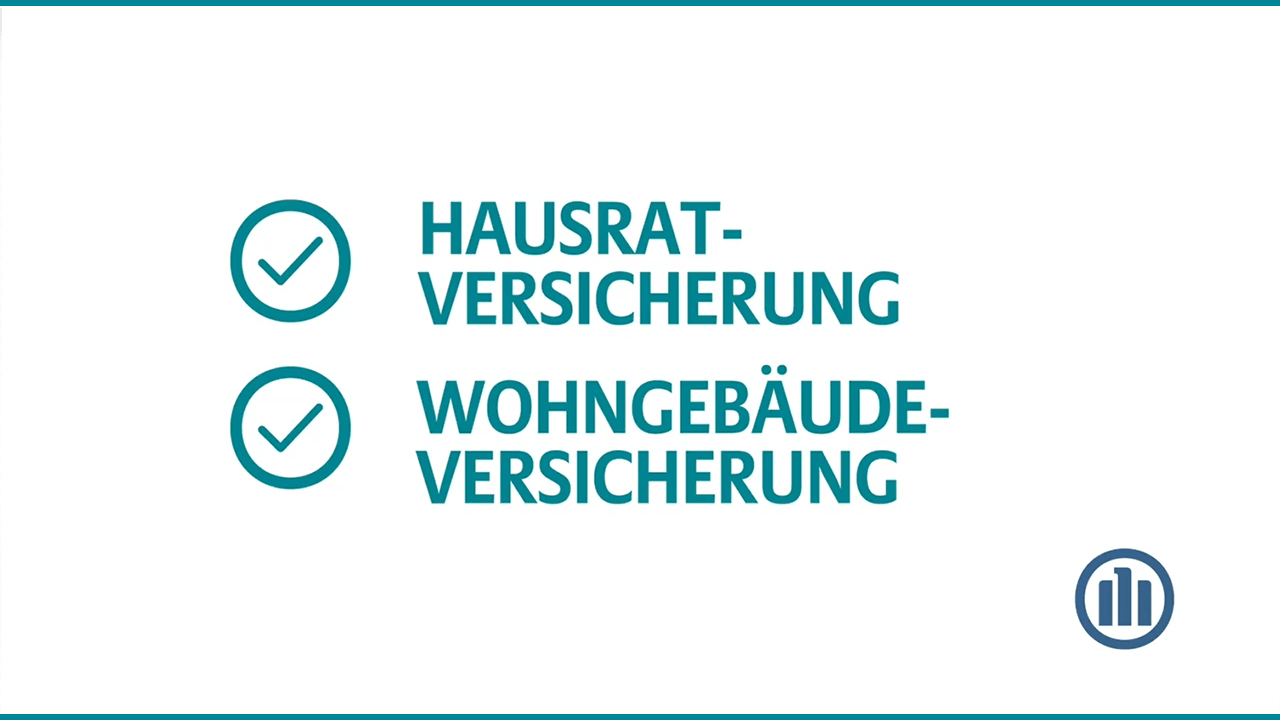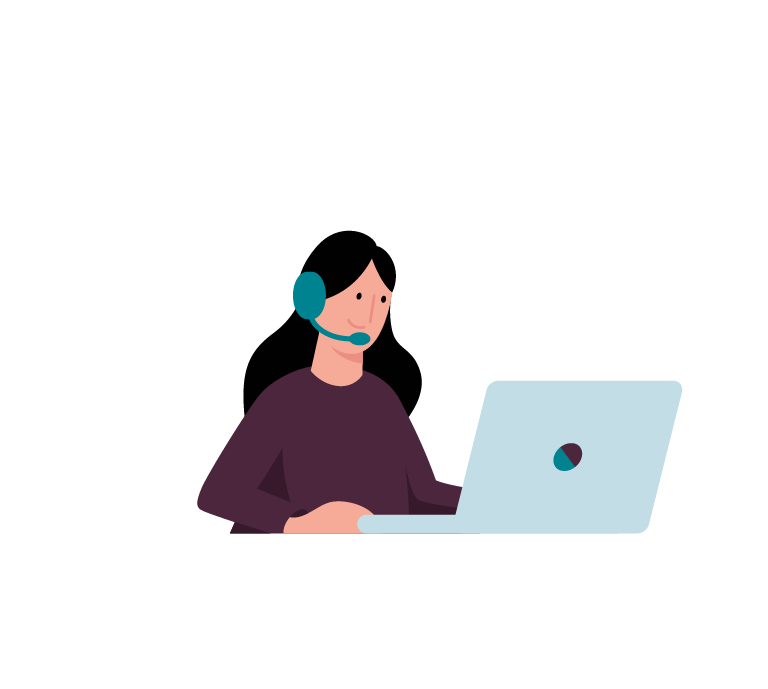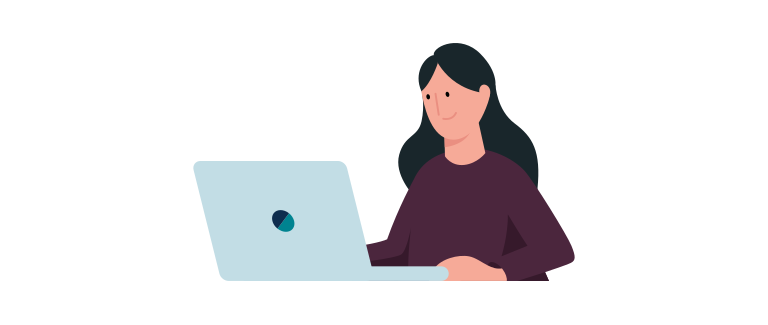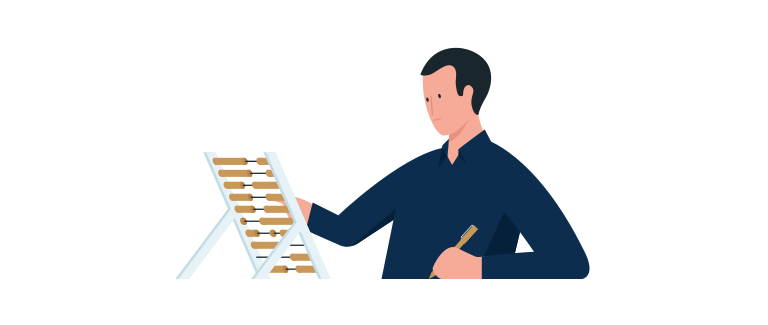Tarife der Wohngebäudeversicherung im Vergleich
Diese Leistungen sind in allen Angeboten der Allianz Wohngebäudeversicherung enthalten:
|
Versicherte Gefahren
|
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel |
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel |
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel |
Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel |
|---|
|
50.000 € |
500.000 € |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
|
|
5.000 € |
25.000 € |
unbegrenzt |
|
|
|
25.000 € |
unbegrenzt |
|
|
|
|
unbegrenzt |