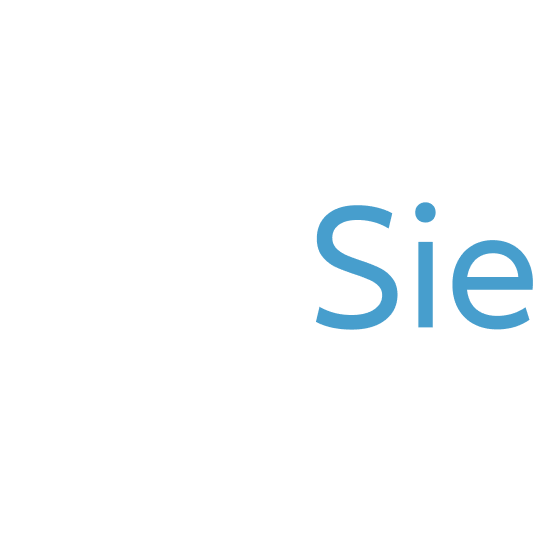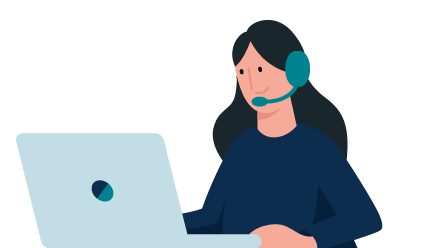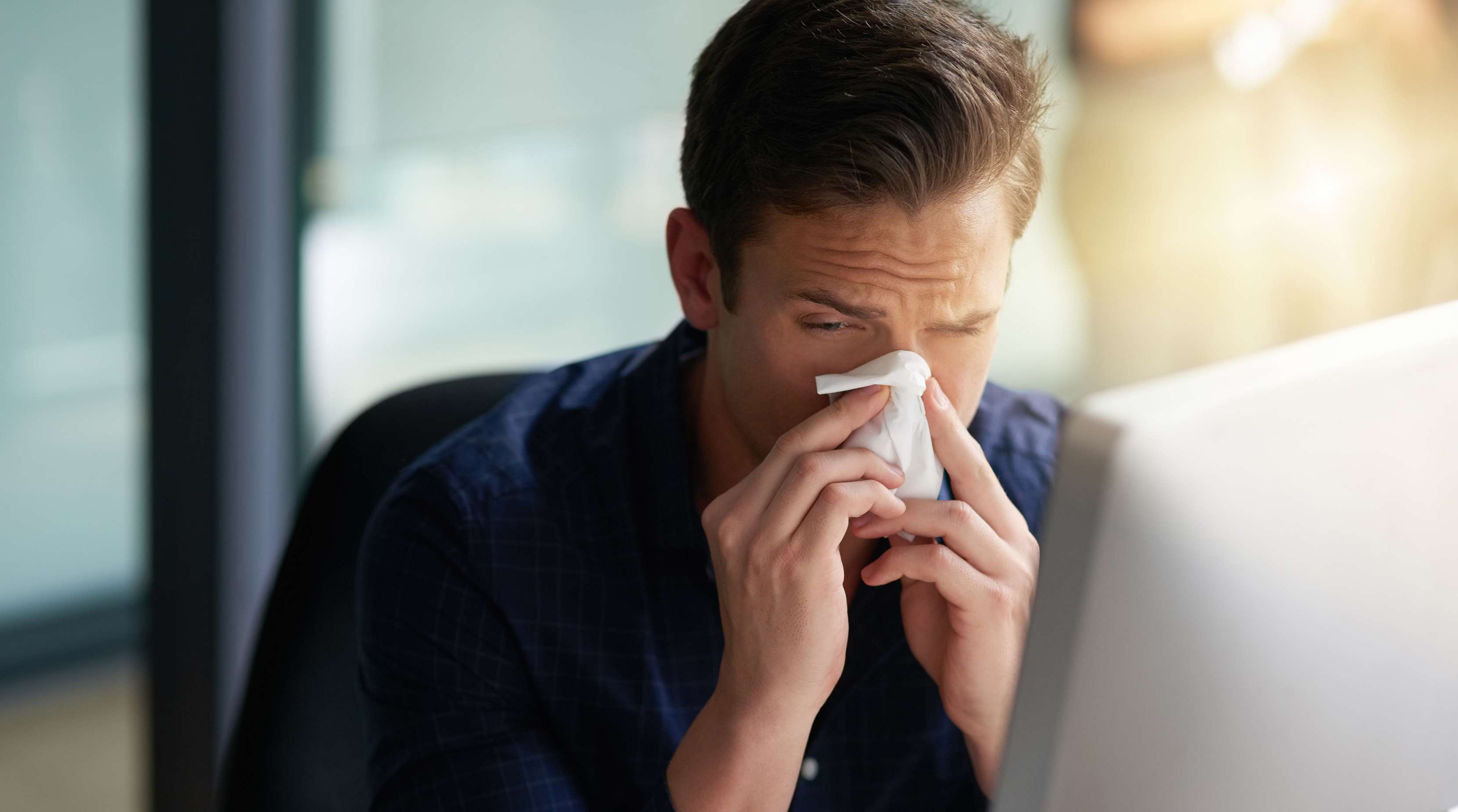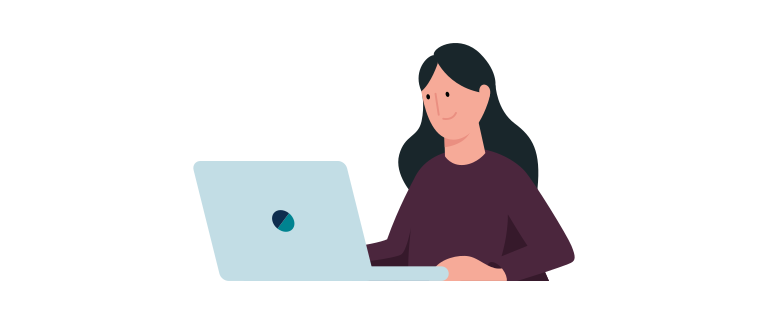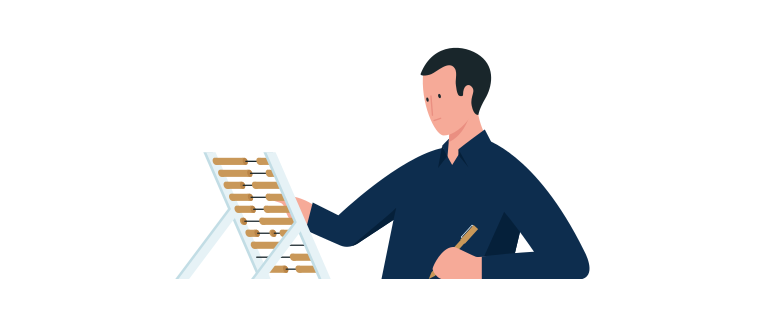Unter Kündigungsfrist ist jene Zeitspanne zu verstehen zwischen Zustellung der Kündigung und der tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Dauer dieser Frist ist abhängig von Ihrem Arbeitsvertrag, sie kann sich aber auch an den gesetzlichen Fristen oder den tariflich festgelegten Kündigungsfristen laut § 622 BGB orientieren. Meist wird im Arbeitsvertrag auf die gesetzlichen Regelungen verwiesen, die dann gelten. Sollte im Angestellten- oder Arbeitsvertrag nichts geregelt sein, gelten die gesetzlichen BGB-Fristen.
Gültig ist die Kündigung, wenn Sie dem Arbeitgeber in Schriftform vorliegt – und sie nicht gegen die Kündigungsfristen verstößt. Wichtig: Steht im Vertrag ein längerer Zeitraum als die gesetzliche Mindestfrist, gilt dieser. Jedoch dürfen die Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer nicht länger ausfallen als für den Arbeitgeber. Eine solche Klausel wäre unwirksam.