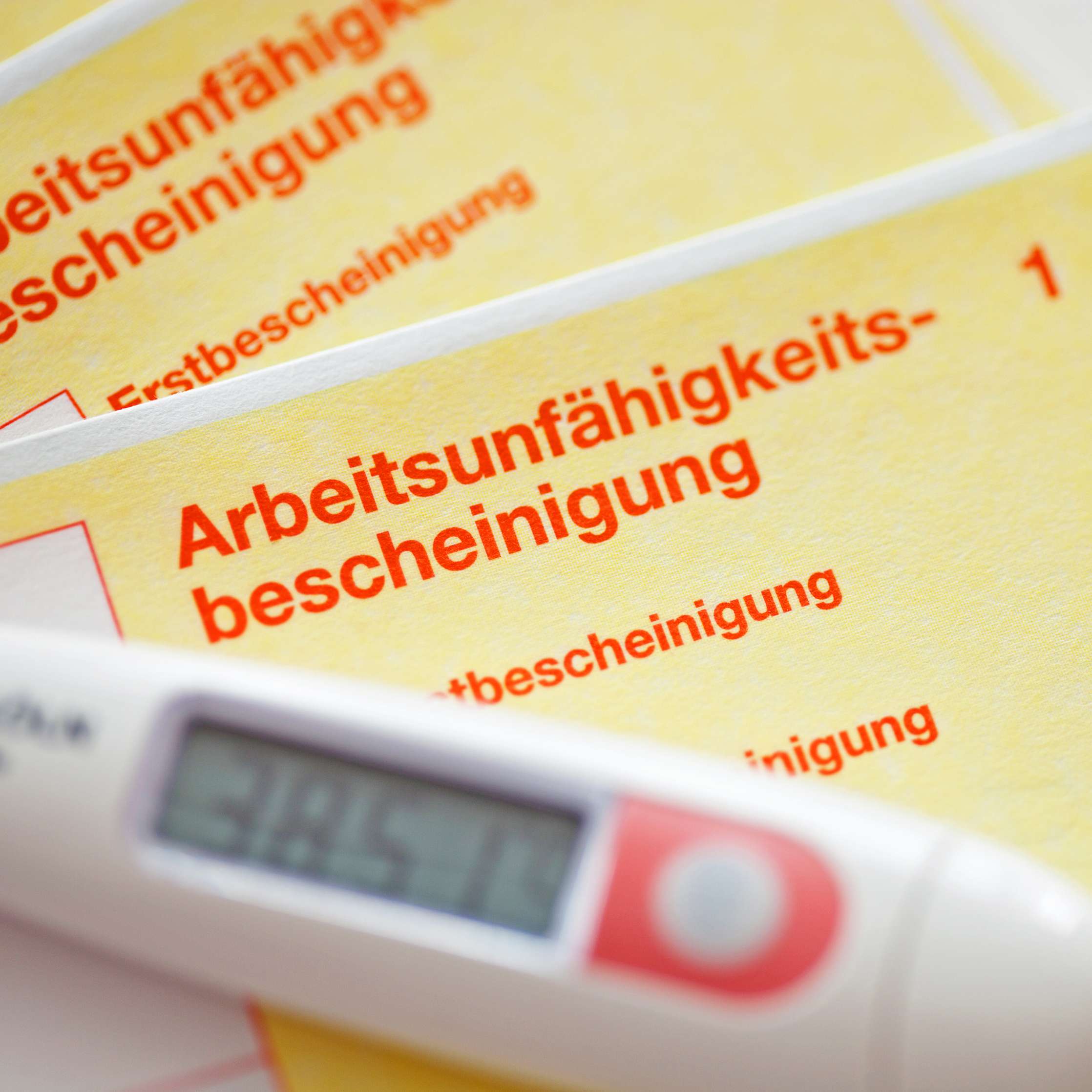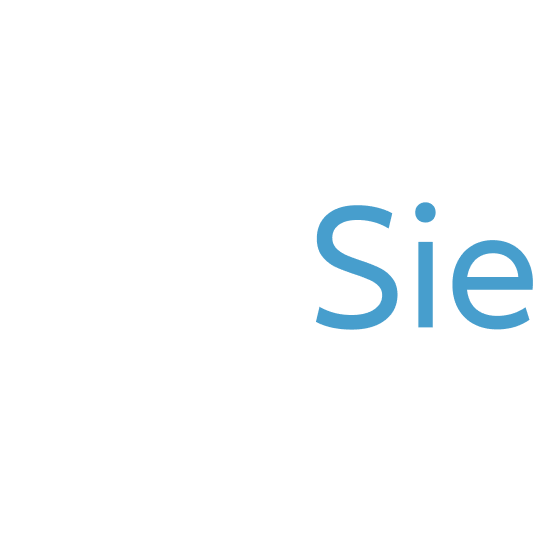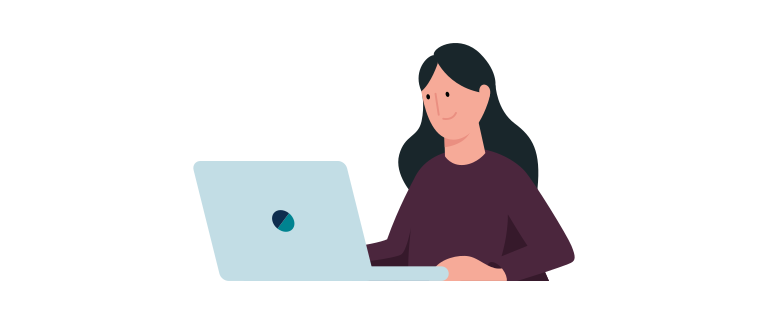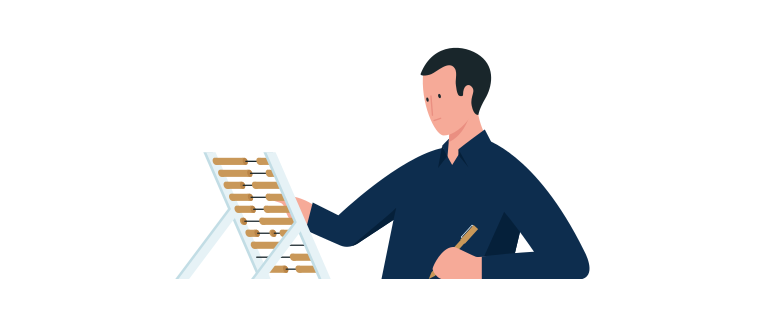Gibt es weitere Besonderheiten aus Arbeitgebersicht?
Grundsätzlich findet bei der Frage, ob ein vom Arbeitnehmer verursachter Schaden zu erstatten ist, eine Abwägung statt. Neben dem Grad des dem Arbeitnehmer zur Last fallenden Verschuldens spielen auch die "Gefahrgeneigtheit" der Tätigkeit und die Schadenshöhe eine Rolle. Wichtig ist aber auch die Frage, ob der Arbeitgeber das Risiko hätte einkalkulieren müssen und durch eine Versicherung abdecken können. Hat er dies nicht, kann ihm das unter Umständen zum Nachteil gereichen, wenn er sich beim Arbeitnehmer nach einem von ihm verursachten Schaden schadlos halten möchte – eben weil er selbst hätte vorsorgen müssen.
Ändert sich für den Arbeitgeber in puncto Haftung etwas, wenn er von einer Krankschreibung wusste, aber toleriert, dass der Mitarbeiter trotzdem arbeitet?
Dies ist im Einzelfall denkbar. Ein krasses Beispiel wäre es etwa, wenn ein Taxifahrer mit Gipsarm zum Dienst erscheint, weil er meint, auch einhändig fahren zu können. Lässt sein Arbeitgeber das wissentlich zu, und es kommt dann zu einem schweren Unfall, dann könnte er sich sicherlich nicht aus einer Mit-Verantwortung stehlen. Heißt verallgemeinert: Wenn klar erkennbar ist, dass ein Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, seine vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen, dann darf der Arbeitgeber ihn auch nicht arbeiten lassen.
Wenn der gleiche Taxifahrer seinen gebrochenen Arm aber verheimlicht, und es auch nicht erkennbar ist, etwa weil er keinen Gips trägt?
Natürlich kann ich dies dann dem Arbeitgeber nicht vorwerfen, da er von der Arbeitsunfähigkeit nichts wusste und davon auch nicht hätte wissen müssen. Eine Haftung setzt in der Regel ein Verschulden voraus. Ein Verschulden könnte in dem wissentlichen Beschäftigen eines Verletzten oder Kranken bestehen – aber das sind wieder Einzelfall-Entscheidungen. Wenn der Taxifahrer aus Ihrem Beispiel also den Bruch und damit die eigentlich bestehende Arbeitsunfähigkeit so gut verheimlicht, dass sie sein Chef nicht erkennen kann, dann ist dem Arbeitgeber zumindest arbeitsrechtlich kein Vorwurf zu machen. Eine mögliche Haftung aus anderen Gründen, etwa als Halter des Fahrzeugs, bliebe davon allerdings unberührt.
Unser beratender Experte ist Rechtsanwalt Oliver Kieferle von der Kanzlei Wolff Schultze Kieferle, Fachanwälte mit Schwerpunkt Arbeitsrecht in München (www.wsk-arbeitsrecht.com).