Pflegetagebuch: Für Sie zusammengefasst
- Im Pflegetagebuch halten Sie fest, welche Pflege- bzw. Hilfeleistungen Sie benötigen und wie groß der Zeitaufwand dafür ist.
- Das Tagebuch ist eine gute Unterstützung, um die Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit festzustellen und Ihnen den passenden Pflegegrad zuzuordnen.
- Für eine nachvollziehbare und verlässliche Aufstellung sollten Sie und/oder Angehörige Ihren Bedarf an Pflege über ein bis zwei Wochen genau festhalten. Im Idealfall führen Sie nicht nur vor der ersten Begutachtung ein Pflegetagebuch. Nutzen Sie es auch danach, damit ein Gutachter für eine mögliche Erhöhung des Pflegegrades bereits eine umfassende Dokumentation erhält.
Wie schreiben Sie ein Pflegetagebuch?
Ab wann und über welchen Zeitraum führen Sie ein Pflegetagebuch?
Führen Sie ein Pflegetagebuch täglich über zwei Wochen
Wie sollten Sie Ihre Pflege dokumentieren?
Pflegetagebuch bei den Pflegegraden 1 bis 5
Pflegetagebuch bei Demenz
Was sind erschwerende Faktoren?
Berücksichtigen Sie im Pflegetagebuch, was Ihnen oder Ihren Angehörigen die Pflege erschweren kann. Dazu gehören unter anderem:
- Körpergewicht über 80 Kilo
- Versteifung der Arm- und/oder Beingelenke
- Unkontrollierte Bewegungen
- Schluckstörungen
- Stark eingeschränktes Hören oder Sehen
- Aufwendige Hilfsmittel (Decken-, Wand-, Treppenlift)
- Schwierige räumliche Verhältnisse (z. B. enges Badezimmer)
- Abwehrverhalten/fehlende Kooperation (etwa wegen Demenz, geistiger Behinderung, psychischer Erkrankung)
- Zeitliche Verhinderungen (zum Beispiel für eine mögliche Verhinderungspflege, wenn der pflegende Angehörige zeitlich verhindert ist)
Tipps für Ihr Pflegetagebuch
Gehen Sie beim Ausfüllen des Pflegetagebuches stets gewissenhaft, ehrlich und präzise vor. Orientieren Sie sich an folgenden Tipps:
- Legen Sie den Fokus nicht zu sehr auf hauswirtschaftliche Hilfen: Hauswirtschaftliche Hilfestellungen, wie beispielsweise kochen, spülen oder Wäsche waschen, sind zwar wichtig zu erwähnen, jedoch nicht im Detail zu beschreiben.
- Achten Sie auf alltägliche Kleinigkeiten: Gerade vermeintlich banale Dinge im Alltag spielen eine wichtige Rolle, wie z. B. das Einschenken von Getränken oder Zubereiten von Obst.
- Pflegeerschwernisse sollten individuell beschrieben werden: Hat der Pflegebedürftige beispielsweise Übergewicht, ist schwerhörig oder sturzgefährdet, sollten Sie die Erschwernisse genau beschreiben.
- Erwähnen Sie Pflegehilfsmittel: Werden behandlungspflegerische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Grundpflege benötigt, so sollten Sie dies unbedingt nennen. Zum Beispiel: Verabreichung von Medikamenten oder das Anziehen von Kompressionsstrümpfen.
- Vermeiden Sie Übertreibungen und Unehrlichkeit: Tragen Sie Pflegetätigkeiten, Hilfestellungen und Pflegezeiten minutengenau ein. Seien Sie ehrlich und beschönigen Sie nichts.
Wie funktioniert die Begutachtung?
Vorbereitung für den Begutachtungstermin
- Führen Sie für mindestens zwei Wochen ein ausführliches Pflegetagebuch.
- Notieren Sie, wobei Sie im Alltag Unterstützung benötigen.
- Bereiten Sie alle ärztlichen Dokumente und einen aktuellen Medikamentenplan vor.
- Falls Sie einen Pflegedienst beschäftigen: Besorgen Sie die Pflegedokumentation.
- Überlegen Sie sich, welche Vertrauensperson dabei sein sollte.
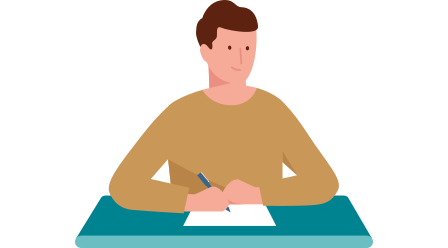
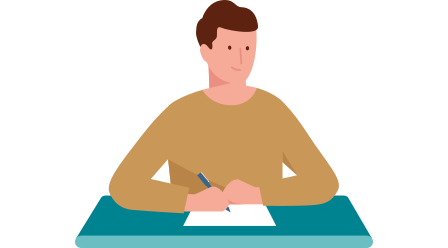

Ablauf der Begutachtung

Was geschieht nach der Begutachtung?



Widerspruch gegen das Ergebnis

Welchen Einfluss hat ein Pflegetagebuch auf das Gutachten?
Der Gutachter hat in etwa nur eine Stunde Zeit für die Beurteilung Ihres pflegebedürftigen Angehörigen. Ein über zwei Wochen präzise geführtes Pflegeprotokoll dient dem Gutachter als optimale Hilfestellung. Im Idealfall erhält er einen Überblick über die physischen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Verhaltensweisen im Alltag des Pflegebedürftigen.
Tipp: Die Begutachtung der individuellen Pflegebedürftigkeit erfolgt im Rahmen des „Neuen Begutachtungsassessment“ (NBA). Bei diesem Verfahren wird in sechs Lebensbereichen der Grad der Selbständigkeit, also das Ausmaß, in dem die pflegebedürftige Person sich noch selbst ohne fremde Hilfe versorgen kann, eingeschätzt.
- Mobilität
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
- Selbstversorgung
- Umgang mit krankheits-/therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
- Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
Die Erstellung des Pflegegutachtens folgt bestimmten Voraussetzungen, die gesetzlich festgelegt sind – im Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI). Dieses regelt unter anderem die Voraussetzungen, wann ein pflegebedürftiger Versicherungsnehmer einen Pflegegrad (bis 2017 Pflegestufe) und entsprechenden Pflegeleistungen erhält.
Die fünf Pflegegrade
-
So werden die fünf Pflegegrade berechnet
Mehr Informationen zu den Pflegegraden finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber.
-
Wie führen Sie die Selbsteinschätzung durch?
Die medizinischen Dienste wie MEDICPROOF bieten Fragebögen an, mit denen Sie den eigenen Pflegebedarf einschätzen können. Ihr Pflegetagebuch hilft Ihnen, diese Bögen auszufüllen. -
Wie stellt man Pflegebedürftigkeit bei Kindern fest?
Bei geistig oder körperlich beeinträchtigten Kindern vergleicht man deren Selbstständigkeit mit der von normal entwickelten Kindern im gleichen Alter. Pflegebedürftige Heranwachsende brauchen mehr Hilfe und Unterstützung im Alltag, beispielsweise beim Anziehen, der Körperpflege oder der Mobilität. -
Welche Besonderheiten gelten bei der Pflegebedürftigkeit von Kleinkindern?
Kinder unter 18 Monaten werden automatisch einen Pflegegrad höher eingestuft, als bei der Untersuchung festgestellt. Damit Eltern und Kind vor monatlichen Begutachtungen bewahrt werden, bleibt dieser Zustand zunächst festgeschrieben. Im 19. Lebensmonat wird das Kind dann in den regulären Pflegegrad eingestuft. Ein neues Gutachten erfolgt in der Regel nur bei starker Veränderung der Selbstständigkeit, beispielsweise nach einer Operation. -
Warum ist das Pflegetagebuch für eventuelle Rentenansprüche relevant?
Wer als pflegender Angehöriger seine Pflegetätigkeit über Jahre gut dokumentiert, der kann eventuelle Pflege-Rentenansprüche erwerben. Konkret bedeutet dies: Ist der wöchentliche Pflegeaufwand für den pflegenden Angehörigen mindestens zehn Stunden und der parallele berufliche Arbeitsaufwand nicht mehr als 30 Stunden, dann kann dieser sein Recht auf Rentenansprüche für den Pflegeaufwand geltend machen.

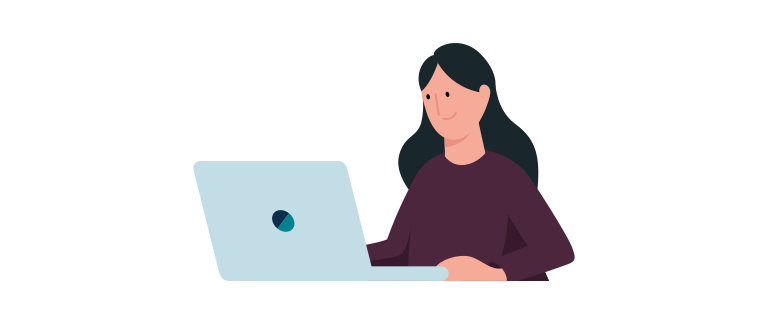
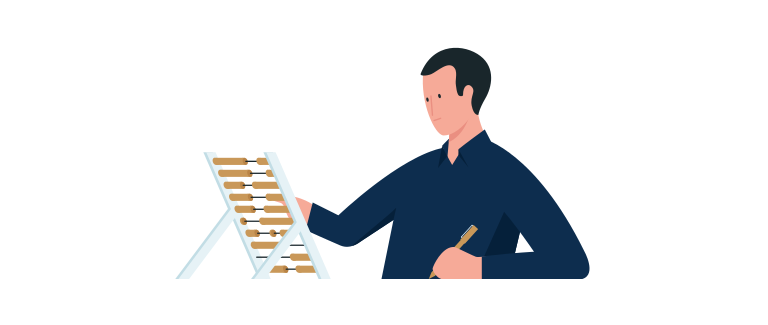
passenden Tarif








