Kurz erklärt in 30 Sekunden
Sarkoid beim Pferd: Auf den Punkt gebracht
- Ein Sarkoid ist die häufigste Tumorart bei Pferden. Die Hautgeschwüre sind in der Regel gutartig, schränken erkrankte Tiere aber teils so stark ein, dass Reiten nicht mehr möglich ist.
- Das Erscheinungsbild von Sarkoiden ist vielfältig. Sie können als einzelne fellbedeckte Warzen, aber auch als großflächige Geschwülste oder offene Wunden auftreten.
- Meist bilden die Tumore sich an dünnen, wenig behaarten Hautstellen, zum Beispiel im Gesicht, im Genitalbereich oder an den Oberschenkelinnenseiten der Vierbeiner.
- Je nach Art und Größe lassen Sarkoide bei Pferden sich unter anderem mit Salben, Bestrahlung oder operativ behandeln.
Ihre Meinung ist uns wichtig
Geben Sie uns ein Feedback
Unsere Empfehlung
Informiert und abgesichert in jeder Situation
Service und Kontakt
Haben Sie noch Fragen zur Pferdekrankenversicherung?


Melden Sie sich bei dem Allianz-Service
Schicken Sie uns Ihre Beratungsanfrage - wir melden uns bei Ihnen.
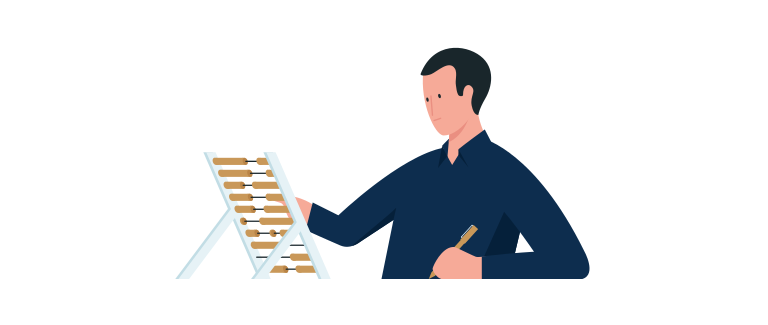
Finden Sie den
passenden Tarif
passenden Tarif
Berechnen Sie Ihren individuellen Tarif zur Pferdekrankenversicherung.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Weitere Service-Angebote







